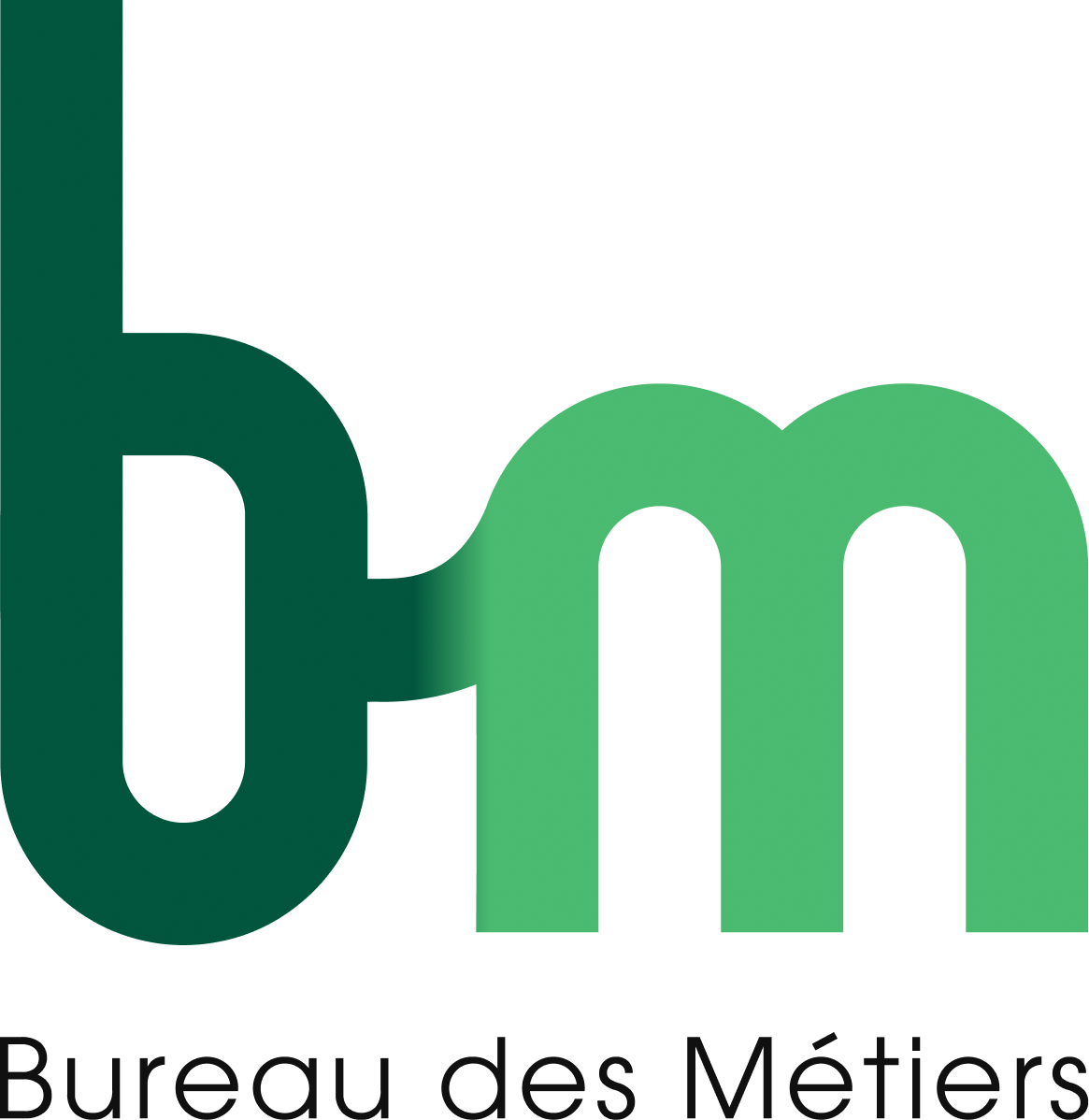Für die Unternehmenden, die unzählige Aufgaben haben und dazu noch Verbands- und Privattätigkeiten ausüben, ist es als Arbeitgebervertreter nicht einfach, alle Details dessen, was bei den Lohnverhandlungen auf dem Spiel steht, zu beherrschen und eine ausreichend globale Vision der Problematik mitzubringen. Das Bureau des Métiers hat aus diesem Grund ein System von Synergien eingeführt, um Informations- und Kompetenzaustausch zu fördern. Konkret bedeutet dies, dass alle Gewerkschaftsforderungen an die Verantwortlichen der Arbeitgeberverhandlungen sämtlicher Verbände übermittelt werden. Sie werden zugleich in einem Dokument zusammengefasst, das alle eingetroffenen Forderungen enthält und vergleicht. Gleich im Anschluss daran versammeln sich die Verantwortlichen der Verhandlungen für die Arbeitgeberseite, um diesen Text durchzugehen und zu besprechen und mit den Wirtschaftsaussichten, der Konjunktur oder der Entwicklung der Konsumentenpreise in Zusammenhang zu bringen. Ohne unbedingt eine gemeinsame Arbeitgeberpolitik anzustreben – denn wie oben erwähnt entspricht jeder GAV anderen Umständen und Fristen – erlaubt dieser Austausch wertvolle Erfahrungen zu teilen, wodurch die kritische Betrachtungsweise der Arbeitgebervertreter geschärft wird. Sobald ein Abkommen abgeschlossen ist, wird ebenso verfahren. Dann werden die genauen Informationen allen weitergeleitet, und in einem entsprechenden Dokument zusammengefasst, das fortwährend aktualisiert wird. Die Tabelle schliesslich, die die wichtigsten Klauseln aller Verträge, die dem Bureau des Métiers bekannt sind umfasst, wird regelmässig aktualisiert und den Arbeitgebervertretern zur Verfügung gestellt.
- 2024-2025.
- Verbände und Arbeitgeberpolitik.
Für eine echte Sozialpartnerschaft.
Die Berufsverbände können selbstverständlich auf die Sozialpartner zählen, wenn es um die Verteidigung der Berufe gegen unlauteren Wettbewerb oder Schwarzarbeit geht. Manches Mal beklagen sie jedoch einen gewissen Mangel an Unterstützung, wenn dieselben Berufe aufgewertet und beworben werden sollen. Die Lage verschärft sich noch, sobald der Gewerkschaftsdiskurs zu sehr auf der Mühsamkeit der Berufe, oder auf den für zu gering eingeschätzten Löhnen beharrt. Derart beschränkte Themen überdecken die beachtenswerten Fortschritte hinsichtlich der Arbeitsbedingungen dank der technischen Entwicklung, ebenso wie die Tatsache, dass die Löhne mit anderen Sektoren durchaus mithalten können. Das Vorgehen der Gewerkschaften untergräbt die konstanten Bemühungen der Verbände neue Berufungen hervorzubringen und den unerlässlichen Nachwuchs für unsere Berufe sicherzustellen.
Selbstverständlich gehört es zur Aufgabe der Gewerkschaften die Arbeitnehmenden zu verteidigen – obschon manchmal mit etwas Übereifer. Dennoch sollten sie nicht aus den Augen verlieren, dass sie auch Partner sind. Man erwartet von ihnen, dass sie all ihre Kraft dafür einsetzen, um gemeinsam mit den Verbänden realistische, konstruktive und pragmatische Lösungen für die Herausforderungen suchen, denen unsere Berufe gegenüberstehen.
Mit der gleichen Einstellung wäre es wichtig, dass die Gewerkschaftsvertreter ihre Verbundenheit mit der Sozialpartnerschaft betonen, wozu auch eine klare Aussage ihrerseits zur kantonalen Initiative zum gesetzlichen Mindestlohn im Wallis zählt.
Dieses Thema könnte man nicht ohne den grösseren Kontext betrachten: die Ausgeglichenheit der Schweiz stützt sich auf ein einfaches, aber wertvolles Prinzip, nämlich eine nationale und kantonale Gesetzgebung, die gewollt flexibel und allgemein gehalten ist. Dieses Prinzip erlaubt den Gesamtarbeitsverträgen sich an die Besonderheiten der einzelnen Branchen anzupassen. Allzu unbeugsame und detaillierte Texte zu unterstützen, käme einer Schwächung der Sozialpartnerschaft in ihrer Rolle und Effizienz gleich. Je mehr das Gesetz darauf abzielt jedes Detail festzulegen, desto mehr verlieren unsere Verträge an Bedeutung und die gesamte Sozialpartnerschaft, die schon seit über hundert Jahren so unerschütterlich und positiv ist, wird geschwächt.