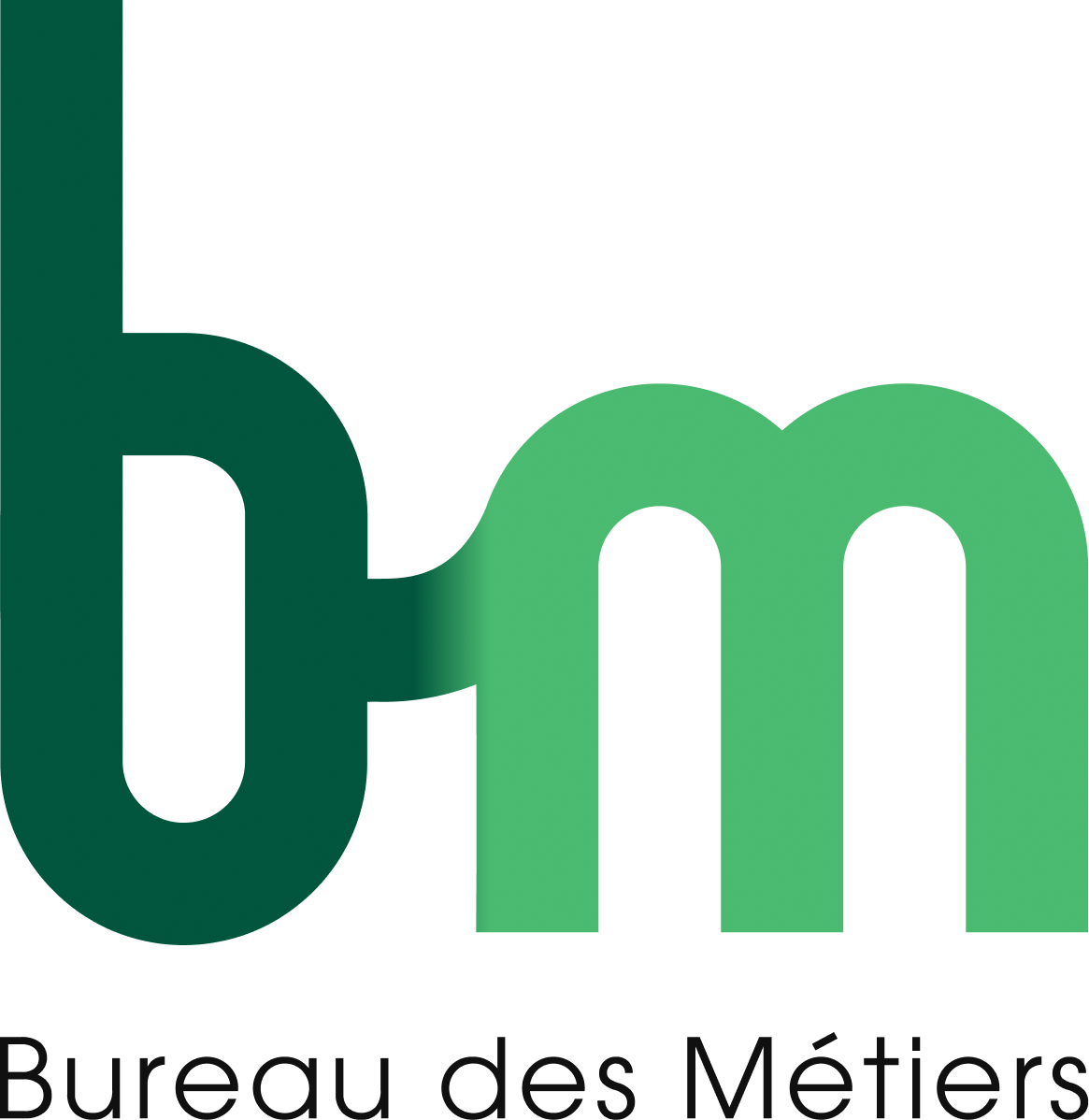Die Grundlagen.
Das Jahr 2024 war geprägt von der Umsetzung der neuen Verordnung über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann. Während der erste Jahrgang Lernender bereits dem neuen Lehrplan folgt, sind bestimmte Modalitäten noch nicht abschliessend geregelt. Darunter insbesondere die digitalen Prüfungen – was regelmässige Anpassungen der Praxis erforderlich macht. Die entsprechende Abstimmung der Inhalte wird von den Berufsverbänden sowie den Kursverantwortlichen laufend gewährleistet. Für die Qualitätsgarantie der Ausbildung in den überbetrieblichen Kursen sorgen regelmässige Besuche der Klassen. Die innovative Einführung eines Online-Eignungstests direkt in den Ausbildungsbetrieben des Elektrogewerbes stellt die erste konkrete Anwendung der digitalen Werkzeuge in der Auswahlphase der Lernenden dar.
In den Berufen des Ausbaugewerbes bleibt die Beherrschung der grundlegenden technischen Fertigkeiten eine unabdingbare Voraussetzung. Die Methoden zur Erlangung der Fachkenntnisse wandeln sich dennoch allmählich – dank Plattformen für die Berufsbildung, Videoanleitungen und digitalen Werkzeugen. Damit sich diese Entwicklungen positiv auswirken, ist es unumgänglich das digitale Lernen auf solide Grundpfeiler zu stellen. Die Fähigkeit Pläne zu lesen, die Materialien richtig zu handhaben und die Sicherheitsratschläge zu befolgen – all das sind Grundkompetenzen, die vollständig integriert werden müssen, damit die Technologie die Berufsbildung bereichert, ohne ihre Genauigkeit anzutasten.
Die künstliche Intelligenz – zwischen Versprechen und Vorsicht.
Der Aufschwung der künstlichen Intelligenz eröffnet neue Perspektiven für die praktische Ausbildung. Sie könnte beispielsweise den Aufbau von individuellen Berufswegen ermöglichen, oder Hilfestellung bei der Verbesserung bestimmter technischer Aufgaben leisten. Trotzdem wirft sie auch gewichtige pädagogische Fragen auf: erleichtert sie wirklich die Berufslehre, oder vermindert sie die unvermeidlichen Anstrengungen? Die Verlockung systematisch schnelle Lösungen zu nutzen, könnte sich schädlich auf den Erwerb vertiefter Kenntnisse auswirken. In diesem Zusammenhang bleibt die Rolle der Berufsbildner im Zentrum: sie müssen die Verwendung dieser Technologien einrahmen, ihr Grenzen setzen und für eine konkrete Verankerung in der Berufsrealität sorgen.
Eine Kehrtwende, die gezielte Investitionen erfordert.
Der digitale Wandel setzt bedeutende Investitionen voraus. Dies sowohl für Ausstattungen und Lizenzen wie für den Zeitaufwand zur Ausbildung der Personen, die für die Lernenden verantwortlich sind. Die KMU, die oft stark gefordert sind, müssen bei dieser Herausforderung angemessen unterstützt werden. Immer mehr Berufe integrieren nunmehr die digitalen Werkzeuge in ihre Berufspraxis. Deshalb braucht man kompetente Berufsbildner, die deren Nutzung beherrschen und diese Kenntnisse an die jungen Generationen weitergeben.
Unter guten Rahmenbedingungen bedeutet diese Entwicklung eine herausragende Gelegenheit zur Modernisierung. Wie bei jedem Wandel, können Widerstände aufkommen – doch die Erfahrung zeigt, dass manches auf den ersten Blick komplex erscheint und dann unumgänglich wird. Vorausgesetzt natürlich, man verpasst den Zug nicht.